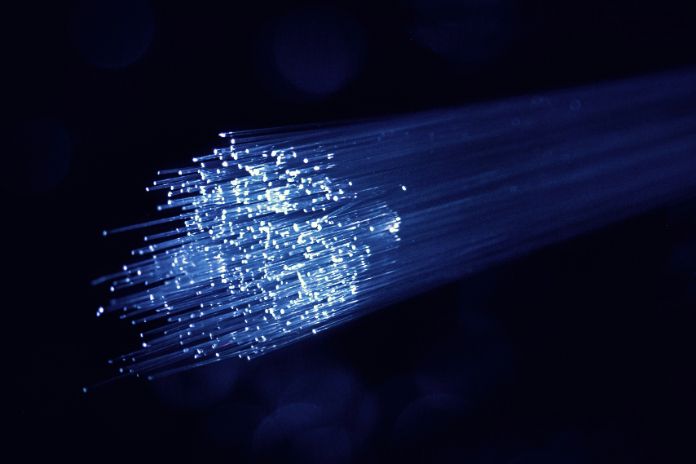Infrastruktur
Eine zukunftsorientierte digitale Infrastruktur ist die Grundvoraussetzung, damit die Stadt München Dienste digital anbieten kann. Neben der Breitbandversorgung per Glasfaser und Funk gehört auch das „Internet der Dinge“ („IoT“) zur Basistechnologie von vielen Smart-City-Lösungen, um Antworten auf Herausforderungen der Zukunft zu geben: städtisches Wachstum, Klimawandel, wachsender Ressourcenverbrauch und die Mobilitätswende.
Diese Grundlagen ermöglichen auch die umfassende digitale Transformation der Stadt- und Quartiersplanung. Optimierte Abläufe sowie die Standardisierung von Prozess- und Datenschnittstellen verbessern die Zusammenarbeit entlang des Lebenszyklus von Stadtquartieren und Gebäuden. Digitale Lösungen tragen ferner dazu bei, Ziele im Bereich der Abfallvermeidung zu erreichen und die Verwertung von Ressourcen im Sinne der Kreislaufwirtschaft zu verbessern.
Maßnahmen
Ziele des Handlungsfeldes
Maßnahmen
Die Stadt München bietet kostenfreies WLAN an öffentlichen Plätzen und in städtischen Gebäuden. Das Angebot richtet sich an alle Münchner*innen, aber auch an die Gäste aus dem In- und Ausland. Unter Federführung des IT-Referats und in Kooperation mit den Stadtwerken München wird das Netz stetig ausgebaut.
Umsetzungszeitraum: 2020-2025
Mit M-WLAN will die Landeshauptstadt den Menschen in München digitale Teilhabe ermöglichen. Ziel ist es dabei, an strategisch sinnvollen, zuvor durch die Stadtverwaltung und die Gemeindeausschüsse geprüften Stadtorten Internet für die öffentliche Nutzung bereitzustellen.
Die LHM verwaltet beziehungsweise genehmigt pro Jahr circa 63.500 Maßnahmen auf öffentlichem und privatem Grund, unter anderem Baumaßnahmen, Veranstaltungen, Versammlungen, Filmdrehs, gewerbliche Sondernutzungen (zum Beispiel Freischankflächen). BAU-ER zielt auf die referatsübergreifende Optimierung der Prozesse zur Verwaltung, Genehmigung, Abrechnung und Koordinierung aller Flächensondernutzungen der LHM. Hierzu wird eine zentrale, integrierte IT-Lösung zur Verfügung gestellt. Das Verwaltungshandeln wird als digitale, medienbruchfreie Ende-zu-Ende-Prozesse gestaltet (von der Online-Antragstellung bis zur Bescheid-Generierung und Abrechnung) und die digitale Verwaltung aller Dokumente ermöglicht. Über Self-Service-Dienste wird den Firmen, externen Organisationen und Bürger*innen die Antragstellung ermöglicht, sowie zusätzliche Kommunikationskanäle und Informationen zur Verfügung gestellt. Die Informationen zu den Flächensondernutzungen werden zudem in einer geografischen Karte dargestellt und als Datenbasis für die Verkehrssteuerung im Mobilitätsreferat verwendet.
Umsetzungszeitraum: 2016-ca.2027
Mit dem Baustellen- und Ereignismanagement sollen die Prozesse zur Koordinierung und Genehmigung von Baustellen und weiteren Sondernutzungen in einer zentralen Anwendung digital gebündelt werden.
Die Stadtwerke München erschließen seit 2007 München mit einem Glasfasernetz. Der Ausbau des Münchner Glasfasernetzes erfolgt schrittweise und nachhaltig. Bis zum Abschluss des Ausbaus im Jahr 2025 werden ca. 80% der Münchner Haushalte angeschlossen sein. Der Ausbau der Mobilfunk-Infrastruktur erfolgt durch privatwirtschaftliche Anbieter. Die öffentliche Hand greift (lediglich) durch flankierende Maßnahmen, wie Richtlinien und Genehmigungsverfahren, in den Infrastrukturausbau ein und gestaltet diesen aktiv mit. Die Stadt München unterstützt den Ausbau darüber hinaus durch die Bereitstellung von Standorten für Funkanlagen (Masten, Antennen und Kleinzellen) auf öffentlichen Liegenschaften, eine mobilfunkgerechte Bauleitplanung, sowie durch die effiziente und transparente Gestaltung von Genehmigungsverfahren für Masten und sonstige Sendeanlagen.
Umsetzungszeitraum: 2007-2025
Ziel der Maßnahme ist eine flächendeckende Netzabdeckung mit Glasfaser und Mobilfunkempfang – auch in Stadtrandgebieten. 2024 will das Projekt Fördermittel für den Ausbau des Glasfasernetzes durch die Telekom in einem Stadtrandgebiet beantragen.
Die Stadt München will die vorbereitende (Flächennutzungsplanung) und die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplanung) vollumfänglich digital unterstützen. Durch die Einführung, Anpassung und Vernetzung mehrerer digitaler Werkzeuge werden die Prozessschritte im Rahmen der Bauleitplanverfahren digital bearbeitbar. Mit der Einführung eines Fachportals wird die Beteiligung der Bürger*innen und Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Verfahren online ermöglicht (BOM -Bauleitplanung Online München). Die vollumfängliche digitale Unterstützung der umfangreichen Geschäftsprozesse ermöglicht unter anderem auch eine verbesserte Prozesssteuerung und damit eine Beschleunigung und größere Transparenz in den Verfahren für alle Beteiligten.
Umsetzungszeitraum: 2022-2026
Ziel der Maßnahme ist die vollumfängliche digitale Abbildung von Verfahren der vorbereitenden (Flächennutzungsplan) und verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) nach den Vorgaben des Baugesetzbuches.
Die Stadt München digitalisiert ihre Prozesse in der Entsorgungslogistik und Kreislaufwirtschaft und optimiert damit die Logistik des Abfallwirtschaftsbetriebes einheitlich und standardnah. Unterschiedliche Planungsaufgaben (sowohl Revier-als auch Streckenplanung) werden digital unterstützt sowie die gesamte Ressourcendisposition (Personal und Equipment) modernisiert und erleichtert. Die bestehenden (Standard-) Prozesse und fachlichen Abläufe werden auf ihr Optimierungspotenzial geprüft, wo nötig neugestaltetund Schritt für Schritt an die bestehende Digitalisierungslösung (SAP) angebunden. Dies ermöglicht zudem eine mobile Auftragsbearbeitung vor Ort, inklusive einer zeitnahen Rückmeldung, um Steuerungsprozesse zu unterstützen. Die Entsorgungslogistik und Kreislaufwirtschaft der LHM wird durchgehend digitalisiert und medienbruchfrei ausgestaltet und kann somit effizienter, schneller und flexibler auf die heutigen und künftigen Anforderungen reagieren. Dadurch können Datenqualität und -verfügbarkeit erhöht und auch der Papierverbrauch deutlich reduziert werden. Die Prozesse zur Sammlung, Verwertung und Entsorgung von Wertstoffen und Abfällen werden optimiert.
Umsetzungszeitraum: 2022-2026
Die Digitalisierung der Entsorgungslogistik in München zielt auf effizientere Planung, moderne Ressourcendisposition und mobile Auftragsbearbeitung ab. Prozesse werden standardisiert, optimiert und an die SAP-Lösung angebunden. Medienbrüche werden eliminiert, Datenqualität und -verfügbarkeit verbessert und der Papierverbrauch reduziert. Dies ermöglicht eine eine mobile Auftragsbearbeitung vor Ort sowie flexiblere und schnellere Steuerung von Sammlung, Verwertung und Entsorgung, um heutige und zukünftige Anforderungen besser zu erfüllen.
Im Rahmen des Förderprojektes "Connected Urban Twins" werden in Kooperation mit den Städten Hamburg und Leipzig innovative Anwendungsfälle für Stadtentwicklung und Bürger*innenbeteiligung entworfen und etabliert. Die Stadt München ermöglicht so neue innovative Planungsansätze und unterstützt planerische Handlungsnotwendigkeiten. Die Verknüpfung der Stadtentwicklung mit dem Digitalen Zwilling und der urbanen Datenplattform erschließt neue Wissens-und Steuerungspotentiale. Mit den Anwendungsfällen wird gezeigt, wie neueste Technologie und intelligent genutzte Daten das Wissen und die Steuerungsfähigkeit von Städten zur Lösung von Zukunftsfragen steigern können. In dieser Maßnahme steht die digitale Unterstützung der Partizipation der Münchner Bürger*innen an der Stadtentwicklung im Zentrum.
Umsetzungszeitraum: 2021-2025
Das „Internet der Dinge“ (Internet of Things – IoT) ermöglicht eine Vielzahl innovativer Anwendungsfälle in Bereichen wie Mobilität, Energie, Sicherheit oder Umwelt. Verschiedene Sensoren wie zum Beispiel Füllstands- oder Verkehrsflusssensoren sammeln Daten, die für die rechtzeitige Leerung von Containern oder eine optimierte Verkehrssteuerung genutzt werden.
In einem ersten Prototyp wurden 80 Altkleidercontainer in der Stadt mit Sensoren ausgerüstet und über das LoRA-Netzwerk und die integrierte IoT-Plattform der Stadtwerke München (SWM) vernetzt. Durch die Anbindung der IoT-Plattform an den Digitalen Zwilling der Stadt stehen die Daten der Stadt München jederzeit zur Visualisierung und zur Analyse zur Verfügung und können zum Beispiel für eine optimierte Routenplanung genutzt werden.
In einem ersten Schritt wurden in prototypartigerweise 80 Altkleidercontainer in der Stadt mit Sensoren ausgerüstet und über das LoRA-Netzwerk und die integrierte IoT-Plattform der Stadtwerke München (SWM) vernetzt. Durch die Anbindung der IoT-Plattform an den Digitalen Zwilling der Stadt stehen die Daten in der LHM jederzeit zur Visualisierung und zur Analyse zur Verfügung und können zum Beispiel für eine optimierte Routenplanung genutzt werden.
Der Aufbau eines stadtweiten IoT-Ökosystems in enger Zusammenarbeit mit den dazu erforderlichen LHM-internen und externen Partnern, wie zum Beispiel SWM soll in den nächsten Jahren durch die Nutzung und ggfs. Ausbringung von geeigneter fachbezogener Sensorik sowie durch den Aufbau oder Nutzung entsprechender IoT-Plattformen entlang von konkreten fachlichen Anwendungsfällen der Referate und Eigenbetriebe intensiviert werden.
Umsetzungszeitraum: 2022-2025
Gemeinsam mit internen und externen Partnern, wie zum Beispiel den Stadtwerken München soll in den kommenden Jahren ein stadtweites IoT-Ökosystem aufgebaut werden. Konkrete fachliche Anwendungsfälle der Referate und Eigenbetriebe bilden dabei die Grundlage für die Einbindung weiterer fachbezogener Sensoren sowie entsprechender IoT-Plattformen.